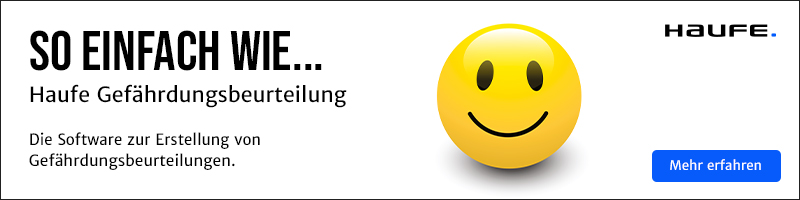Wie wäre es, die zuständige TAP Deiner BG hierzu zu befragen?
Möchte die Führungskraft noch nicht, weil dann sofort klar ist, um wen (Führungskraft + Mitarbeiter) es sich handelt.
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenWie wäre es, die zuständige TAP Deiner BG hierzu zu befragen?
Möchte die Führungskraft noch nicht, weil dann sofort klar ist, um wen (Führungskraft + Mitarbeiter) es sich handelt.
Guten Morgen,
in unserem Museum wird eine historische Maschine restauriert. Einige Bestandteile dafür, wurden vom dort tätigen Handwerker im "Homeoffice" angefertigt. Aufgrund seines bisherigen beruflichen Werdegangs ist seine private Werkstatt all unseren Werkstätten, was die Ausstattung angeht, weit überlegen.
Wie würdet ihr den Schutz über die Unfallversicherung sehen, wenn in dieser Konstellation etwas passiert?
- Versichert: Das "Homeoffice" erfolgt mit Genehmigung der Führungskraft.
- Versichert: Die Führungskraft macht sich aber haftbar, da sie eine sicherheitswidrige Anweisung gibt (Arbeiten mit Werkzeugen und Maschinen, die keiner nachweislichen Prüfung unterliegen, da nicht vom Arbeitgeber gestellt.)
- Nicht versichert: ???
Alles anzeigen...in einem organisierten Betrieb ist es nicht schwierig, Stichwort: Organigramm (welches es doch sicher auch im ÖD gibt, oder?!?) Geh' einfach diese Hierarchie durch.
Am Ende steht auch hier der Unternehmer.
Zugegeben, formal schwierig wird es natürlich wenn man bedenkt, dass Freigestellte grundsätzlich weisungsfrei arbeiten. Ohne jetzt rechtsverbindlich antworten zu können, existiert hier eine Lücke im entsprechenden Rechtsbereich, die nie so wirklich hinterfragt wird.
Im Tagesgeschäft war es in meinen Betrieben i.d.R. so, dass wir GB's für Bürotätigkeiten aus Verwaltungsabteilungen übernommen haben, und zusätzliche Bereiche, wie z.B. Betriebsbegehungen, gesondert betrachtet haben. Dies ist gemeinsam mit BR Mitgliedern erstellt worden. Unterweisungen hat die SiFa im Auftrag des Unternehmers und in Abstimmung mit dem BR durchgeführt (Hey, jetzt kommt mir nicht wieder mit "weisungsbefugt")
In diesem Sinne
Der Michael
Natürlich steht der Behörderleiter ganz oben, aber er ist auch der Erste, der es definitv nicht machen wird!
Bei der praktischen Umsetzung hilft daher auch kein Organigramm.
Die Delegierung auf einen Amtsleiter etc. wäre meine erste Lösung. Ich wollte aber auch mal wissen, wie andere das umgsetzt haben, sodass es auch funktioniert.
Die Sifa-Lösung würde ich gern vemeiden, da dass zu viel Unruhe bei den anderen Führungskräften auslösen würde.
Unsere Gleichstellungsbeauftragte hat neuerdings eine Sachberbeiterin und ist damit zur Führungskraft geworden. Sie hat wie alle FK eine Pflichtendelegation im Arbeitsschutz plus Beratungsgespräch bekommen und weiß jetzt, dass sie für GBU, Unterweisungen, Arbeitsmedizinische Vorsorge etc. verantwortlich ist. Beim Betriebsrat ist das genauso, dort ist der Vorsitzende die Führungskraft für die Schreibkraft, nicht für das Gremium.
Welch höhrere Führungskraft kontrolliert die Umsetzung und führt die Unterweisung durch? Die Einordnung ist bei uns ein wenig schwierig.
Verantwortlich ist auch hier der Unternehmer!
Wer ist denn in dieen Bereichen verantwortlich, also wer führt diese Beschäftigten?!?!
In diesem Sinne
Der Michael
entschuldige..."zuständig" war das absolut falsche Wort... ![]()
Zuständig ist natürlich der Arbeitgeber aber wie habt ihr das geregelt/umgesetzt? Wer wurde mit dieser Aufgabe betraut?
Hallo zusammen,
bei uns kam die Frage auf, wer für die Gefährdungsbeurteilungen/Unterweisungen der freigestellten Interessenvertretungen zuständig ist? In unserem Beispiel sind das der Personalrat (3x), Gleichstellungsbeauftragte (2x) und Schwerbehindertenvertretung (1x).
Wie ist das bei euch geregelt?
Es gab auch mal den Fall, dass ein Versicherter auf dem Weg zur Arbeit einen Umweg gefahren ist, weil er zum Bäcker wollte. Auto geparkt, 100m gelaufen und dann gesehen, dass die Schlange vorm Bäcker zu lang ist und er nicht pünktlich auf der Arbeit ankommen würde.
Auf dem Weg zurück zum Auto ist er dann verunfallt und dies ging auch so durch.
Habs damals auch nicht verstanden.
Und heute macht es nur Sinn, wenn der "Rückweg" tatsächlich versichert wäre.
folgendes wurde verbraucht:
- 5 Augenkompressen
- 10 Päckchen sterile Wundauflage
- 1 Rettungsdecke
- 2 Mullbinden klein
- 2 Mullbinden groß
Klingt nach einer außergewöhnlichen DIN ![]()
Lerne die Leute kennen, lass dir die Bereiche nach und nach zeigen und vor allem von den Leuten die dort arbeiten erklären!
Kliniken sind ein super interessantes Aufgabengebiet, da stinken eine Menge Industriebereiche in der Breite der Gefährdungen gegen ab :D.
Zum Schluss musst du halt noch irgendwie versuchen mit dem ärztlichen Personal klarzukommen :-D.
Ist es möglich direkt zu der Karte eine Legende zu erstellen bzw. wird diese auch über die Software erstellt?
Guten Morgen,
wir haben eine Menge Betriebsanwiesungen ausschließlich digital auf einem Laufwerk liegen (Ausnahmen bei erhöhten Gefährdungen). So müssen die MA durch Unterweisung wissen, wo die Betriebsanweisungen zu finden sind.
Der QR-Code macht das auffinden der Betriebsanweisungen sogar noch einen Schritt einfacher.
Die TRGS 555 spricht ebenfalls nur davon, dass Betriebsanweisungen an geeigneter Stelle an der Arbeitsstätte - möglichst in Arbeitsplatznähe - zugänglich zu machen sind.
Das von der UK NRW und Tüv kann man leider vergessen.
Welches Seminar der UK NRW meinst du genau?
Ich war schon bei vielen guten Seminaren der UK NRW.
Wir bieten die Grippeschutzimpfung seit Jahren nicht mehr an, da diese nicht zum Betriebsarzt, sondern bei der Allgemeinmedizin anzusiedeln ist.
Dadurch, dass z.B. die Grippeschutzimpfung aber während der Arbeitszeit angeboten wird, nehmen diese viel mehr Personen wahr, als wenn diese erst einen Termin beim Hausarzt machen müssen.
Wir hatten einen ähnlichen Fall.
Haben es aber über die Raumbeleuchtung gelöst und die Röhren gegen LED ausgestauscht, die in Lichtfarbe und Helligkeit frei einstellbar sind.
Funktioniert aber nur, weil die Kollegin bei Anwesenheit alleine im Büro ist.
meine Meinung: erst durch ein physische Begehung bekommt man ein umfassendes und realistisches Bild von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen und Gefährdungen in den Arbeitsstätten.
Auch bei einer Begehung erhälst du in der Regel kein umfassendes Bild. Selbst die Unfallversicherungsträger weisen in ihren Begehungsberichten darauf hin.
"Bitte beachten Sie, dass durch eine Betriebsbegehung nicht alle sicherheitstechnischen und organisatorischen Defizite offenkundig werden."
Zum Thema:
Ich würde mich nicht gerne per iPad durch die Gegend schleppen lassen. Einzelene Arbeitsplätze habe ich aber auch schon per Fotosichtung "begangen".
Höhenverstellbare Schreibtische werden nicht mehr bezuschusst (SGB IX mal außen vor).
Für die Schule macht ein höhenverstellbarer Schreibtisch wenig Sinn. Den überwiegenden Teil während des Unterrichts wird deine Bekannte ja nicht sitzen.
Für zuhause muss deine Bekannte, genau wie alle anderen, die Kosten selber tragen.
Danke für die Antworten und Bestätigung...mal sehen, wie groß der Shitstorm wird... ![]()
Hallo zusammen,
ich habe die Tage eine Arbeitsstätte besichtigt, die über eine außenliege Fluchttreppe verfügt.
Der Handlauf bzw. die Umwehrung war 0,9 m hoch.
Laut Landesbauordnung NRW ist das OK.
(4) Andere notwendige Umwehrungen müssen folgende Mindesthöhen haben:
1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnungen in begehbaren Decken und Dächern sowie Umwehrungen von Flächen mit einer Absturzhöhe von 1 m bis zu 12 m 0,90 m und
2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als 12 m Absturzhöhe 1,10 m.
Laut ArbStättV (ASR A2.1) sind die 0,9 m nicht ausreichend.
(2) Die Umwehrungen müssen mindestens 1,00 m hoch sein. Die Höhe der Um-
wehrungen darf bei Brüstungen bis auf 0,80 m verringert werden, wenn die Tiefe der
Umwehrung mindestens 0,20 m beträgt und durch die Tiefe der Brüstung ein gleich-
wertiger Schutz gegen Absturz gegeben ist.
Beträgt die Absturzhöhe mehr als 12 m, muss die Höhe der Umwehrung mindestens
1,10 m betragen.
Ergibt sich bei der Gefährdungsbeurteilung, dass in bestehenden Arbeitsstätten die
Einhaltung der Höhe der Umwehrung mit Aufwendungen verbunden ist, die offensicht-
lich unverhältnismäßig sind, so hat der Arbeitgeber dies individuell zu beurteilen.
Die ArbStättV ist doch aufgrund des Schutzwirkung höher zu bewerten als die LBO?
Kann der Vermieter eine Erhöhung der Umwehrung um 0,1 m als "zu teure" Aufwendung ablehnen? Im Prinip müsste er nur einen zusätzlichen Handlauf auf den bestehenden anbringen.